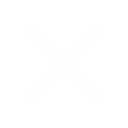Aktuelles aus unserem Immobilien-Blog
Urteil: Kein Vertrag bei unglücklicher Verwechslung
Ziehen Mieter in eine neue Wohnung, erhalten sie automatisch Strom von einem Grundversorger – es sei denn, sie entscheiden sich für einen Wahlversorger. Doch was passiert, wenn sich ein Mieter für einen Wahlversorger entschieden hat, es aber zu einer Verwechselung der Zählernummern zweier Nachbarwohnungen kommt? Darüber entschied nun das Amtsgericht Frankfurt am Main [Aktenzeichen 29 C 903/21 (19)].
Im vorliegenden Fall hatte eine Immobilienverwaltung einer neuer Mieterin versehentlich die Zählernummer der Nachbarwohnung mitgeteilt. Die Mieterin schloss also mit der vermeintlich richtigen Zählernummer einen Vertrag mit einem Wahlversorger ab. Nachdem die Verwechslung aufgefallen war, informierte die Mieterin ihren Wahlversorger und teilte ihm die richtige Zählernummer, also die ihrer Wohnung, mit. Der Wahlversorger passte seine Abrechnungen entsprechend an.
Der Grundversorger, der ebenfalls Leistungen zur Verfügung gestellt hat, forderte nun allerdings Geld von der Mieterin. Diese sah es jedoch nicht ein, die Rechnung zu begleichen. Daraufhin verklagte der Grundversorger die Mieterin. Die Klage hatte jedoch keinen Erfolg. Laut Amtsgericht Frankfurt am Main war zwischen den Parteien kein Stromlieferungsvertrag zustande gekommen. Schließlich wollte die Mieterin einen Vertrag mit einem Wahlversorger und nicht mit dem Grundversorger abschließen.
Quelle: ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de
Beschluss: Grundstückseigentümerin muss für Rattenbekämpfung sorgen
Auch wenn eine Eigentümerin nichts für Schädlinge auf ihrem Grundstück kann, muss sie diese bekämpfen und die Kosten dafür tragen. So entschied es jetzt zumindest das Verwaltungsgericht Berlin (VG 14 L 1235/22). Im vorliegenden Fall hatte eine unbekannte Person Ratten auf einem Grundstück in Berlin-Reinickendorf mit Futter und Getränken versorgt. Der Rattenbefall war dem Gesundheitsamt gemeldet und von mehreren Personen unabhängig voneinander bestätigt worden.
Das Gesundheitsamt führte eine Ortsbesichtigung durch. Nach dieser verpflichtete das Bezirksamt Reinickendorf die Eigentümerin dazu, innerhalb von einer Woche eine Fachkraft mit der Rattenbekämpfung zu betrauen und das Bezirksamt hierüber schriftlich zu informieren. Geschehe das nicht, wolle das Bezirksamt die Rattenbekämpfung selbst vornehmen und der Eigentümerin die Kosten hierfür in Rechnung stellen.
Daraufhin reichte die Eigentümerin einen Eilantrag ein, jedoch ohne Erfolg. Die Pflicht der Eigentümerin zur Rattenbekämpfung ergebe sich in diesem Fall aus der Verordnung über die Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen. Die sei auch dann der Fall, wenn die Eigentümerin kein Verschulden und keine Verantwortlichkeit für die Entstehung des Rattenbefalls trifft. Gegen den Beschluss kann die Eigentümerin noch Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einlegen.
Quelle: berlin.de/VG 14 L 1235/22
Studie: Zahlreiche Heizungsanlagen über 25 Jahre alt
Gut 52 Prozent der Wohnungen in Deutschland werden mit Erdgas beheizt. Das geht aus der Verbrauchskennwerte-Studie 2021 des Energiedienstleister Techem hervor. Für die Studie wurden die Daten zum Endenergie- und Wasserverbrauch sowie die Kosten für Heizung und Warmwasser von 2,1 Millionen deutschen Wohnungen in rund 176.000 Mehrfamilienhäusern untersucht.
Bei der Studie wurden auch mehr als 90.000 aktuell erstellte Energieausweise geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass ein Drittel der Heizungsanlagen älter ist als 25 Jahre und somit laut Techem „ineffizient“. Durch Maßnahmen wie einen hochautomatisierten Heizungsanlagenbetrieb, ein kontinuierliches Heizungsmonitoring sowie eine optimierte Betriebsführung kann die Effizienz bei der konventionellen Wärmeerzeugung laut Techem im Bestand um etwa 15 Prozent gesteigert werden.
Eine optimale Gebäudedämmung biete zudem Energiesparpotenziale von 30 bis 50 Prozent. Außerdem können auch die Mieter mit einem richtigen Lüftungsverhalten zum Energiesparen beitragen und den Verbrauch dadurch um 10 bis 15 Prozent reduzieren. „In Zeiten der Gaskrise und angesichts notwendiger Dekarbonisierung im Gebäudebestand müssen alle Marktteilnehmer zusammenrücken und gemeinsam Energieeffizienzlösungen entwickeln“, so Matthias Hartmann, CEO bei Techem.
Quelle: techem.com
Bau: HDB und bbs fordern Stärkung der heimischen Rohstoffproduktion
Die Abhängigkeit von Rohstoffimporten zu verringern und die heimische Rohstoffproduktion zu stärken – das fordern der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) und der Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden (bbs) im gemeinsamen Positionspapier „Versorgungssicherheit mit Roh- und Baustoffen sowie Energie gewährleisten – Ressourceneffizienz weiter steigern“. Die Verbände fürchten, dass Deutschland ohne bezahlbare Energie und eine wirksame Verschlankung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren ein zunehmender Mangel an mineralischen Rohstoffen droht.
„Wir haben uns in den vergangenen Jahren zu wenig Gedanken über Lieferabhängigkeiten gemacht. Das rächt sich jetzt“, meint HDB-Geschäftsführer Tim-Oliver Müller. Zwar gebe es für die kommenden Jahrzehnte voraussichtlich genügend Rohstoffe. Jedoch scheitere die Rohstoffgewinnung in der Praxis häufig an hohen regulatorischen Hürden und langwierigen, verzögerten Genehmigungsverfahren. bbs-Hauptgeschäftsführer Dr. Matthias Frederichs geht sogar noch einen Schritt weiter. Er meint, dass es ohne heimische Rohstoffe kein bezahlbares Bauen mehr gibt.
Die Verbände fordern auch, neue Wege zu gehen und beispielsweise sogenannte Sekundärrohstoffe, die als Abfälle von Produktionsverfahren gelten, in öffentlichen Ausschreibungen zuzulassen. Zudem müssen Planungs- und Genehmigungsverfahren ihrer Ansicht nach beschleunigt werden. Das vollständige Positionspapier können Interessenten kostenlos downloaden, und zwar unter bauindustrie.de und baustoffindustrie.de.
Quelle und weitere Informationen: bauindustrie.de
Urteil: Schäden müssen von allen Wohnungseigentümern beglichen werden
Entsteht nach einem Leitungswasserschaden aufgrund mangelhafter Leitungen in der Wohnung eines Wohnungseigentümers ein Schaden, muss dieser von allen Wohnungseigentümern gemeinschaftlich beglichen werden. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH)/Urteil vom 16. September 2022 – V ZR 69/21 V ZR 69/21. Im vorliegenden Fall hatte eine Eigentümergemeinschaft zwar eine Gebäudeversicherung für das Sonder- und Gemeinschaftseigentum abgeschlossen. Aufgrund wiederholter Vorfälle kommt diese jedoch nur noch für 25 Prozent der Schäden auf.
Wegen des gestiegenen Selbstbehalts der Gebäudeversicherung forderte eine Klägerin nun unter anderem eine von der bisherigen Praxis abweichende Verteilung des Selbstbehalts. Die Kosten werden bislang von einer Verwalterin nach Höhe der Miteigentumsanteile unter den Eigentümern aufgeteilt. Die Klägerin wollte erreichen, dass sie nicht mehr an den Kosten beteiligt wird, die nach ihrer Ansicht ausschließlich am Sondereigentum der Beklagten entstanden sind.
Die Klägerin scheiterte vor dem BGH aktuell zwar und muss sich an den Kosten beteiligen. Jedoch hat der BGH einen Punkt ans Berufungsgericht zurückverweisen. Dieses muss nun noch darüber entscheiden, ob der Verteilungsschlüssel künftig geändert werden kann. Laut BGH müssen Wohnungseigentümergemeinschaften zwar gemeinsam Beschlüsse fassen. Im vorliegenden Fall könnte es sich aber um eine „unbillige Belastung der Klägerin“ handeln, da die Leitungswasserschäden im Bereich der Wohneinheiten und nicht in ihrer Gewerbeeinheit auftreten.
Quelle: V ZR 69/21/bundesgerichtshof.de
Licht: Beleuchtungstipps für Garten und Balkon
Wie der Balkon mit einer Beleuchtung gemütlich in Szene gesetzt werden kann, beleuchtet das Portal home24.de. Beim Kauf der Beleuchtung sollten Eigentümer und Mieter darauf achten, dass sie den verschiedenen Witterungsverhältnissen standhält. Daher müssen höhere Schutzklassen gegen Schmutz und Feuchtigkeit gewählt werden.
Lampen mit der Schutzklasse IP23 eignen sich laut Portal für den Einsatz unter einem bedachten Balkon oder unter dem Dach. Bei einem unbedachten Außenbereich sollten hingegen Lampen mit der Schutzklasse IP44 gewählt werden, die besser vor Wasser geschützt sind. Außerdem sei ein fachgerecht montierter Stromanschluss wichtig.
An einigen Balkonen können Deckenleuchten für das nötige Licht sorgen. Auch der Einsatz einer Akzentbeleuchtung mit LED-Strips oder einer LED-Lichterkette kann sich lohnen. Durch den Einsatz von Lichterketten können kleine Balkone optisch beispielsweise vergrößert werden, da sich die Ecken ausleuchten lassen.
Quelle und weitere Tipps: home24.de
Wasserschadensanierung: Neue Art der Trocknung
Eine neue Art der Trocknung für feuchte Wände aufgrund eines Wasserschades haben Forschende der Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt. Bei „FastDry®“ handelt es sich um eine rechteckige Dämmplatte, die nach einem Wasserschaden an der feuchten Wand angebracht wird. Dabei gelangt der entstehende Wasserdampf durch die Dämmplatte mit integriertem Heizdraht. Die Wärme verbleibt nach Angaben der Forschenden durch die Dämmung in der Wand.
Vorteilhaft an der lautlosen Dämmplatte aus handelsüblicher Mineralwolle, entwickelt von Projektleiter Andreas Zegowitz, Gruppenleiter Wärmekennwerte, Klimasimulation in der Abteilung Hygrothermik, und seinem Team, ist nach Angaben der Forschenden, dass sie wenig Strom benötigt und der Raum nicht unnötig aufgeheizt wird. Außerdem ist Mineralwolle nicht brennbar. Die Dämmplatte erfülle daher auch strenge Brandschutzvorschriften.
Wann die Wand trocken ist, wird unter anderem mittels eines Temperatursensors gemessen, der die Oberflächentemperatur der Wand erfasst. Die Dämmplatte lässt sich dann entweder manuell oder per Fernsteuerung abschalten. Laut Andreas Zegowitz kann die Wand bei „gleichbleibender Temperatur und Energieaufnahme beispielsweise über einen Zeitraum von 24 Stunden […] als trocken angesehen werden“.
Quelle und weitere Informationen: fraunhofer.de
Doppelhaus: BDF weist auf Vorteile hin
Der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) weist auf die Vorteile des Erwerbs von Doppelhaushälften hin. Die Vorzüge seien zum Beispiel die niedrigeren Bau- und Grundstückskosten und niedrige Energiekosten im Vergleich zu Einfamilienhäusern. Die Gründe dafür sind, dass die Bau- und Grundstückskosten durch zwei Parteien geteilt werden und dass Doppelhäuser laut BDF besonders energiesparend gebaut werden.
Auch Grundstücksfläche könne durch den Bau eines Doppelhauses eingespart werden. Zudem können die Doppelhaushälften heute laut BDF heute oftmals individuell statt wie früher nur asymmetrisch gestaltet werden, sofern es der Bebauungsplan erlaubt. So sei nicht nur im Inneren die Erstellung zwei verschiedener Wohneinheiten möglich, sondern sogar die Fassadengestaltung und die Dachform können voneinander abweichen.
Laut BDF verzeichnen Hersteller von Holz-Fertighäusern ein reges Interesse an Doppelhäusern. Daher hätten sie bereits spezielle Grundriss- und Architekturkonzepte entwickelt. „Sie zeigen Baufamilien-Eigenheime, die sich trotz hoher Grundstückspreise und steigender Bauzinsen bezahlbar und individuell umsetzen lassen und obendrein besonders energieeffizient und zukunftssicher sind“, so BDF-Geschäftsführer Achim Hannott.
Quelle: BDF/verbaende.com
Trend: Outdoorküchen
Der Essenszubereitung im Freien kommt laut der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche (AMK) eine immer größere Bedeutung zu. Interessenten können Outdoorküchen in verschiedenen Varianten erwerben. Dabei sollten sie unter anderem darauf achten, dass diese aus witterungs- und UV-beständigen Materialien bestehen und auch die Geräte und Zubehörteile für den Outdoor-Gebrauch konzipiert worden sind. Falls die Outdoorküche nicht unter einer Überdachung steht, empfiehlt sich für die Wintermonate zudem eine Abdeckhaube.
Outdoor-Küchen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Dabei werden laut AMK entweder einzelne Module – für eine größere Flexibilität oftmals auf Rollen – miteinander kombiniert oder komplette Küchenzeilen beziehungsweise Kochinseln zusammengestellt. Die Rahmen bestehen meist aus Edelstahl oder Aluminium. Für die Arbeitsplatten und Schrankfronten werden Materialien wie Keramik, Naturstein, Verbundstoffe oder Kompaktplatten verwendet.
Interessente, die eine Outdoor-Küche erwerben möchten, sollten diese auf einem festen und stabilen Untergrund aufbauen können. Dazu kommt beispielsweise eine Naturstein- oder Holzterrasse infrage. Eine unbefestigte Wiese ist als Standort für Outdoor-Küchen dagegen laut AMK ungeeignet. Die Outdoor-Küchen verfügen auch über Vorrichtungen und Geräte wie ein Spülbecken und einen Kühlschrank. Zu den erforderlichen Wasser- und Stromanschlüssen für diese sollten sich Interessenten laut AMK von Experten im Fachhandel beraten lassen.
Quelle: moebelindustrie.de
Energie: Kosten sparen im Homeoffice
Wie können Arbeitnehmer im Homeoffice Energie sparen? Dieser Frage geht die Verbraucherzentrale Energieberatung nach. Sie weist darauf hin, dass der Stromverbrauch Schätzungen zu Folge unter anderem durch die regelmäßige Verwendung des Laptops, der Schreibtischlampe und des Elektroherds um etwa fünf Prozent steigen kann. Die Mehrkosten belaufen sich dadurch auf etwa 30 Cent bis 1 Euro pro Tag. Zudem müssen noch die Heizkosten hinzugezogen werden.
Um Energie und somit auch Kosten zu sparen, sollten Verbraucher Stromfresser identifizieren und diese ersetzen. Geräte, die nicht gebraucht werden, sollten komplett ausgeschaltet und nicht in den Stand-by-Modus versetzt werden. Denn auch im Stand-by-Modus verbrauchen sie Strom. Außerdem kann die Zimmertemperatur gesenkt werden. Laut Verbraucherzentrale lässt jedes Grad weniger den Heizenergieverbrauch um sechs Grad sinken.
Eigentümer können langfristig gesehen zudem mit einer optimalen Dämmung für einen niedrigen Heizenergieverbrauch sorgen. Interessenten, die weitere Informationen zum Thema „Energie sparen“ bekommen möchten, können sich auf der Seite verbraucherzentrale-energieberatung.de informieren oder sich unter der Rufnummer 0800 – 809 802 400 kostenlos beraten lassen. Zudem bietet die Verbraucherzentrale Energieberatung mehrere kostenlose Online-Vorträge an.
Quelle und weitere Informationen: verbraucherzentrale-energieberatung.de