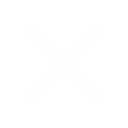Aktuelles aus unserem Immobilien-Blog
Gebäudesanierung: Verfahren zur Effizienzsteigerung
Im Bereich der Gebäudesanierung haben Forschende der Fraunhofer-Gesellschaft innovative Verfahren entwickelt. Ziel ist es, die Sanierungsquote zu erhöhen, um die CO2-Emissionen im Bausektor signifikant zu reduzieren. Aktuell liegt die Sanierungsrate bei etwa einem Prozent pro Jahr. Laut Frauenhofer Gesellschaft „würde es etwa hundert Jahre dauern, den gesamten Gebäudestand zu sanieren“, ginge es im entsprechenden Tempo weiter.
Durch das Projekt „BAU-DNS“ sollen Sanierungsprozesse um 10 bis 15 Prozent beschleunigt werden. Dabei fokussieren die Forschenden auf modulare und zirkulare Ansätze, um die graue Energie zur Gewinnung von Materialien, zur Herstellung von Bauteilen und zur Entsorgung durch biobasierte Materialien und weitere Ansätze zu halbieren und CO2-Neutralität zu erreichen.
Ein Schwerpunkt liegt auf der seriellen Fertigung von Fassadenelementen, die vorproduziert und dann nur noch montiert werden. Dies soll nicht nur Zeit sparen, sondern auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Materialien werden nachhaltig ausgewählt und Prozesse auf Recycling und Rückbau ausgerichtet.
Quelle und weitere Informationen: idw-online.de/fraunhofer.de
Abschläge: So funktioniert die Prüfung von Strom- und Gasrechnungen
Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass Kunden ihre Abrechnungen für Strom, Gas und Fernwärme aus dem vergangenen Jahr prüfen können. Es galten entsprechende Preisbremsen, weshalb dabei einige Besonderheiten zu beachten sind. So entfiel beispielsweise der Dezember-Abschlag für Gas und Wärme für private Haushalte sowie für kleine und mittelständische Unternehmen.
Um die Korrektheit der Jahresabrechnung zu prüfen, rät die Verbraucherzentrale unter anderem zur Kontrolle der Zählernummer, des Anfangs- und Endzählerstands sowie des neuen Abschlags. Ob die Erstattungen stimmen, können Verbraucher anhand des Abschlags unter Berücksichtigung der Preisbremse sowie anhand es Entlastungsbetrags berechnen. Entsprechende Beispiele führt die Verbraucherzentrale auf.
Wem diese Berechnungen zu kompliziert sind, kann mit einem Online-Rechner der Verbraucherzentrale seinen Abschlag für Strom, Gas oder Fernwärme ermitteln lassen. Dazu müssen unter anderem die Abschläge pro Jahr, der Jahresverbrauch in kWh aus der vergangenen Jahresabrechnung sowie der Bruttopreis in kWh angegeben werden.
Quelle und weiter Informationen: verbraucherzentrale.de
Wegerecht: Darf der Nachbar übers Grundstück gehen?
In vielen Fällen möchten Eigentümer ihre Ruhe im Garten genießen, doch das Betreten durch Nachbarn kann zur Belastung werden. Das Landgericht Lübeck hat entschieden, dass Nachbarn unter bestimmten Umständen dennoch ein Recht auf den Durchgang über das Grundstück haben (AZ: 3 O 309/22).
Im konkreten Fall stritten sich zwei Nachbarn, eine Frau und ein Mann. Da das Grundstück des Mannes sich in einem sogenannten Hinterlandquartier befindet und über keinen direkten Zugang zur Straße verfügt, muss er den Weg über das Grundstück der Nachbarin nutzen. Diese störte sich jedoch so sehr daran, dass sie ihm den Weg irgendwann mit Steinen versperrte.
Der Mann klagte daraufhin und bekam Recht. Die Richter sprachen ihm das Notwegerecht zu. Allerdings kann die Frau gemäß Paragraf 917 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches eine Gebühr für die Nutzung des Weges erheben.
Hausbau: Wichtige Tipps für Bauherren (Teil 1)
Bevor der Traum vom eigenen Haus Wirklichkeit wird, sollten Bauherren sorgfältige Entscheidungen treffen und eine gründliche Planung durchführen. Darauf weist das Portal „baumentor.de“ hin und bietet eine Checkliste mit 15 wichtigen Fragen als Orientierungshilfe für die erfolgreiche Umsetzung des Bauprojekts. In einer dreiteiligen Serie fassen wir die Fragen zusammen. Heute: Punkte 1 bis 5.
Die erste Frage lautet „Wo soll das Haus stehen?“ Die Auswahl des Standorts ist laut des Portals „baumentor.de“ von entscheidender Bedeutung für das zukünftige Zuhause. Die Lage beeinflusst nicht nur die Wohnqualität, sondern auch den Wert der Immobilie. Bei der Entscheidung zwischen Stadt und Land sollten die Vor- und Nachteile sorgfältig abgewogen werden. Im zweiten Schritt müssen Bauherren klären, welchen Haustyp sie wünschen – zum Beispiel ein Einfamilienhaus, eine Doppelhaushälfte oder einen Bungalow. Außerdem müssen unter anderem auch Fragen zum Stil, der Größe sowie der Zimmeraufteilung geklärt werden. Bauherren sollten in einem dritten Schritt der Fragen nachgehen, ob sie durch den Bau einer Einliegerwohnung profieren könnten.
Auch der Energieeffizienzstandard spielt beim Hausbau eine Rolle. Laut „baumentor.de“ sollte daher bei Punkt 4 geklärt werden, welches Ausmaß das richtige ist. Das Portal rät zu Passivhäusern und Plusenergiehäusern. Diese benötigen nicht nur wenig Energie, sondern die überschüssige Energie kann auch eingespeichert werden. In einem fünften Schritt sollten Bauherren klären, ob für sie ein Fertighaus oder ein Massivhaus die bessere Wahl ist. Der Vorteil eines Fertighauses ist, dass es meist schnell beziehbar ist. Der Bau eines Massivhauses kann zwar länger dauern, dafür ist aber die Gestaltungsfreiheit größer.
Quelle: baumentor.de
© immonewsfeed
Pflanzen: Passende Auswahl für jeden Raum
Farben beeinflussen unsere Stimmung und unser Wohlbefinden. Insbesondere Grün, das mit Natur und Frische verbunden ist, spielt eine wichtige Rolle für das Raumklima. Grünpflanzen können die Luftqualität verbessern und somit zu einem gesünderen Wohnraum beitragen. Doch welche Pflanzen eignen sich am besten für die verschiedenen Wohnbereiche?
Das ist wichtig zu wissen, denn Zimmerpflanzen erfüllen in verschiedenen Räumen unterschiedliche Zwecke. Im Wohnzimmer können große Pflanzen wie Ficus oder Palmen nicht nur die Luft reinigen, sondern auch optische Akzente setzen. In der Küche fühlen sich neben Kräutern auch Pflanzen wie Farne und Efeututen wohl. Für das Badezimmer eignen sich tropische Pflanzen wie Bambus oder Aloe Vera, die eine hohe Luftfeuchtigkeit vertragen.
Im Schlafzimmer werden besonders Pflanzen wie Bogenhanf und Einblatt empfohlen, da sie auch nachts Sauerstoff produzieren. Bei der Auswahl der Pflanzen müssen allerdings noch weitere Aspekte beachtet werden. So sollte vorab geprüft werden, ob die entsprechende Pflanze schädlich oder giftig für Kinder oder Haustiere sein kann, wie teuer diese sind und wie hoch der Pflegeaufwand ist.
Quelle: lifepr.de/Town & Country Haus Lizenzgeber GmbH
Immobilienpreise: Trends bis 2035
Die Immobilienpreise werden unter anderem in den sieben größten Städten Deutschlands, aber auch in weiteren Regionen anziehen. In fast der Hälfte der untersuchten Regionen (47 Prozent) werden die Kaufpreise real um mehr als 0,15 Prozent bis 2035 anziehen. Das geht aus dem „Postbank Wohnatlas 2024“ des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) hervor. Die Entwicklung wird durch eine zunehmende Nachfrage in zentralen Lagen bei gleichzeitig begrenztem Angebot getrieben.
In München wird ein durchschnittliches Preiswachstum pro Jahr um 1,84 Prozent erwartet, in Frankfurt am Main um 1,67 Prozent und in Köln um 1,43 Prozent. 2023 lagen die Preise in München durchschnittlich bei 8.909,30 Euro, in Frankfurt am Main bei 6.178,54 Euro und im Köln bei 4.862,11 Euro pro Quadratmeter.
Doch während in den Städten mit steigenden Immobilienpreisen zu rechnen ist, kann es in ländlichen oder strukturschwachen Regionen zu fallenden Immobilienpreisen kommen. In diesen Gebieten fehlen oft die wirtschaftlichen Impulse und demografischen Entwicklungen, die in den Städten für eine positive Preisentwicklung sorgen. Am stärksten an Wert verlieren werden Immobilien laut Studie voraussichtlich im Landkreis Mansfeld-Südharz (Sachsen-Anhalt) und in der thüringischen Stadt Suhl.
Quelle und weitere Informationen: postbank.de
Mietende: Wer zahlt bei verspäteter Wohnungsrückgabe?
Muss ein Mieter immer eine Nutzungsentschädigung zahlen, wenn er die Wohnung verspätet zurückgibt? Mit dieser Frage hat sich kürzlich das Landgericht Hanau befasst (Aktenzeichen 2 S 35/22). Im vorliegenden Fall hatte der Mieter seine Wohnung zum 31. August 2017 gekündigt. Der Vermieter widersprach der Kündigung jedoch wegen einer Kündigungsausschluss-Klausel im Mietvertrag. Es kam zum Rechtsstreit.
Der Mieter zog aus, zahlte die Miete aber aufgrund des laufenden Gerichtsverfahrens unter Vorbehalt weiterhin. In der Wohnung ließ er jedoch noch einige Möbel stehen. Das Amtsgericht und das Landgericht Hanau haben derweil in einem Vorprozess festgestellt, dass die Kündigung des Mieters wirksam ist. Der Mieter forderte daraufhin seine unter Vorbehalt gezahlte Miete zurück, der Vermieter dagegen die eine Nutzungsentschädigung in Miethöhe.
Das Gericht entschied weitestgehend zu Gunsten des Mieters. Der Vermieter hätte keinen Anspruch auf Nutzungsentschädigung. Er habe nicht beabsichtigt, die Wohnung zurückzunehmen. Die Möbelunterstellung wurde jedoch als Ausnahme betrachtet. Der Mieter muss für den entsprechenden Zeitraum deshalb einen monatlichen Betrag von 120 Euro an seinen ehemaligen Vermieter zurückzahlen. Die Entscheidung des Landgerichts Hanau ist noch nicht rechtskräftig.
Quelle: ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de/AZ: 2 S 35/22
Forschung: Energieeffizienter Kühlschrank mit Nickel-Titan entwickelt
Einen Prototyp für einen Kühlschrank, der mit Nickel-Titan kühlt, hat ein Forschungsteam um Prof. Dr. Stefan Seelecke und Prof. Dr. Paul Motzki von der Universität des Saarlandes entwickelt. Der Kühlschrank wird auf Basis der sogenannten Elastokalorik betrieben. Diese basiert auf dem einfachen Prinzip, Wärme mittels gezogener und entlasteter Nickel-Titan-Drähte abzuführen. Diese „künstlichen Muskeln“ nehmen Wärme auf und geben sie wieder ab, ohne auf klimaschädliche Kältemittel zurückzugreifen.
Durch die Elastokalorik-Technologie können Temperaturdifferenzen von bis zu 20 Grad Celsius erzeugt werden. Damit gilt sie nicht nur als effizienter, sondern auch umweltfreundlicher als herkömmliche Verfahren. Ein entsprechend betriebener Kühlschrank ist somit eine energieeffiziente und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Kühlsystemen. Bislang passt in den Mini-Kühlschrank gerade einmal eine kleine Flasche.
Die Wirkung elastokalorischer Materialien übertrifft laut Universität des Saarlandes die Wirkung herkömmlicher Klimaanlagen oder Kühlschränke um mehr als das Zehnfache. Sowohl das US-Energieministerium als auch die EU-Kommission sehen in der Elastokalorik eine vielversprechende Alternative zu bisherigen Verfahren. Durch dieses Verfahren können nicht nur kleine Kühlschränke, sondern auch große Räume effizient gekühlt und geheizt werden.
Quelle und weiter Informationen: uni-saarland.de
Gartentrend 2024: Regeneratives Gärtnern
Regeneratives Gärtnern ist mehr als nur ein Trend – es ist eine nachhaltige Methode, die darauf abzielt, die Gesundheit des Bodens zu verbessern, die Biodiversität zu fördern und natürliche Ressourcen zu schonen. Hier sind einige der wichtigsten Praktiken und Tipps für 2024:
1. Bodenpflege und Kompostierung
Der Boden ist das Herzstück des regenerativen Gärtnerns. Eine gesunde Bodenschicht fördert das Pflanzenwachstum und reduziert den Bedarf an chemischen Düngemitteln. Das Hinzufügen von Kompost verbessert die Bodenstruktur und die Nährstoffverfügbarkeit. Durch das Sammeln von Küchen- und Gartenabfälle kann Zuhause nährstoffreicher Kompost entstehen. Dieser kann im Herbst und Frühjahr in den Boden eingearbeitet werden.
2. Mulchen
Mulchen ist eine effektive Methode, um die Bodenfeuchtigkeit zu erhalten, Unkraut zu unterdrücken und die Bodenqualität zu verbessern. Durch die Verwendung organischer Materialien wie Holzspäne, Stroh oder Laub als Mulchschicht wird der Boden geschützt. Außerdem zersetzen sich die Materialien im Laufe der Zeit und fügen dem Boden zusätzliche Nährstoffe hinzu.
3. Fruchtfolge und Mischkulturen
Durch die Rotation verschiedener Pflanzenfamilien kann die Bodenfruchtbarkeit erhalten und Schädlingsbefall minimiert werden. Pflanzen wie Leguminosen (z. B. Bohnen und Erbsen) fixieren Stickstoff im Boden und bereiten ihn für nachfolgende Pflanzen wie Tomaten und Paprika vor, die hohe Nährstoffanforderungen haben. Mischkulturen und Begleitpflanzungen (z. B. Tomaten mit Basilikum und Ringelblumen) können ebenfalls Schädlinge abwehren und das Pflanzenwachstum fördern.
4. Bedeckungskulturen
Bedeckungskulturen wie Klee, Senf oder Roggen schützen den Boden vor Erosion, verbessern die Bodenstruktur und unterdrücken Unkraut. Diese Pflanzen können nach der Ernte ausgesät und vor der neuen Pflanzsaison eingearbeitet werden, um den Boden zu bereichern.
5. Wassermanagement
Eine effiziente Wassernutzung ist entscheidend beim regenerativen Gärtnern. Regenwassersammelsysteme und Tropfbewässerung helfen, Wasser zu sparen und gezielt dort einzusetzen, wo es am meisten benötigt wird. Die Auswahl von trockenheitsresistenten Pflanzen und die Anlage von Mulchschichten tragen ebenfalls dazu bei, den Wasserbedarf zu reduzieren.
6. Förderung der Biodiversität
Eine hohe Biodiversität im Garten fördert ein gesundes Ökosystem. Native Pflanzen können integriert werden, um lokale Insekten und Tiere anzuziehen. Blühpflanzen unterstützen Bestäuber wie Bienen und Schmetterlinge. Zudem sollten Lebensräume für nützliche Insekten und Vögel geschaffen werden.
7. Natürliche Schädlingsbekämpfung
Anstelle chemischer Pestizide werden beim regenerativen Gärtnern natürliche Methoden zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Insekten wie Marienkäfer bekämpfen Blattläusen. Pflanzen wie z. B. Knoblauch oder Lavendel können Schädlinge abwehren.
Fazit
Regeneratives Gärtnern fördert nicht nur die Gesundheit und Produktivität eines Gartens, sondern trägt auch zum Schutz der Umwelt bei. Durch die Implementierung dieser nachhaltigen Praktiken können Gärtner eine blühende, selbstregulierende Gartenlandschaft schaffen, die auch für zukünftige Generationen Bestand hat.
Studie: Häuserpreise sollen laut Commerzbank weiter fallen
Eine erhebliche Korrektur der Wohnimmobilienpreise in Deutschland ist bereits im Gange, und Experten von der Commerzbank prognostizieren weitere Rückgänge in den kommenden Monaten. Offensichtlich klaffe zwischen den Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern weiterhin eine große Lücke.
Die Preise für bestehende Wohnimmobilien sind seit Mitte 2022 deutlich gefallen, insbesondere aufgrund der Zinssteigerungen infolge einer veränderten Geldpolitik der Notenbanken. Die Preise für Bestandsimmobilien waren Ende 2023 durchschnittlich 14 Prozent niedriger als im Frühjahr 2022, die von Neubauten durchschnittlich 5 Prozent niedriger. Geringe Umsätze darauf hin, dass die Preiskorrektur noch nicht abgeschlossen ist.
Trotz des Rückgangs der Immobilienpreise ist die Anzahl der Transaktionen immer noch niedrig, da viele potenzielle Käufer sich, unter anderem aufgrund der aktuellen Finanzierungsbedingungen, den Immobilienkauf nicht leisten können. Die Bundesbank schätzt, dass die Preise noch weiter fallen müssen, damit sie wieder mit Faktoren wie Zinsen und Einkommen im Einklang stehen. „Verglichen mit dem ersten Quartal 2024 besteht nach ihren Schätzungen noch ein weiteres Korrekturpotenzial von 5 bis 10 Prozent“, so die Commerzbank.
Quelle: commerzbank.de